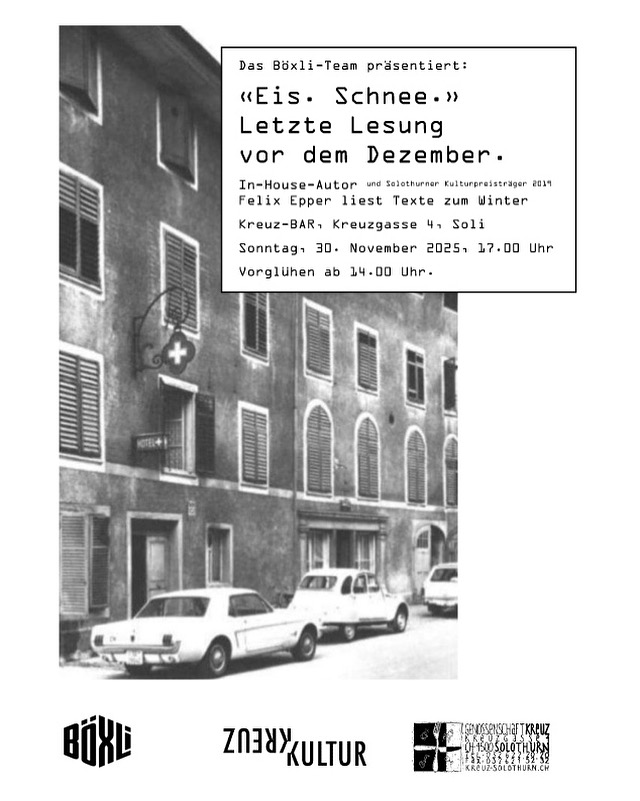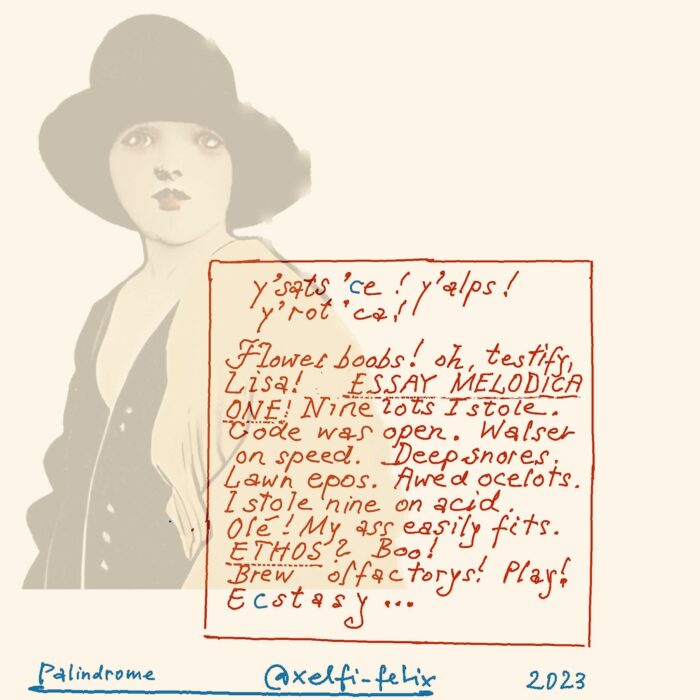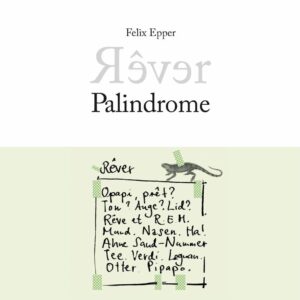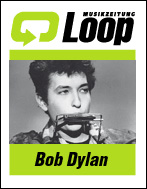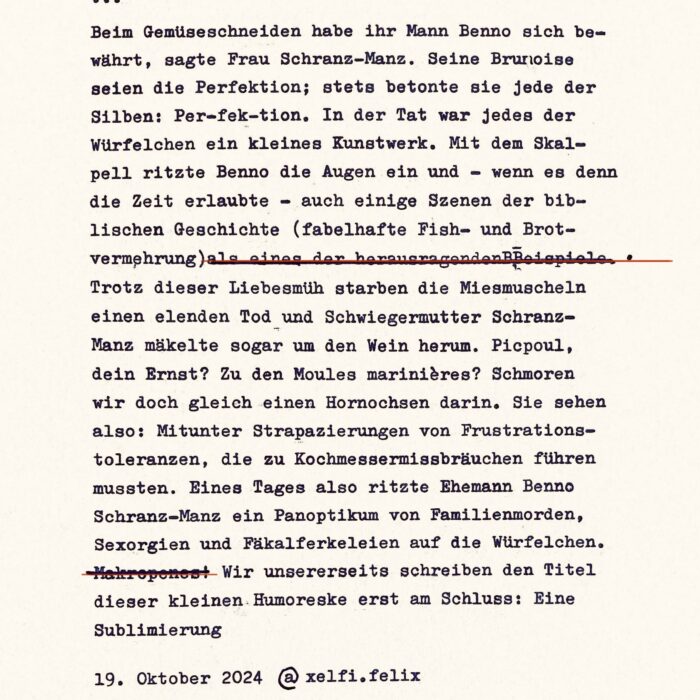Sie hat eben ihren ersten Roman veröffentlicht, ist aber schon seit fünfzehn Jahren im Geschäft. Eine Begegnung mit der Zürcher Schriftstellerin Aglaja Veteranyi.
Vorbemerkung: 05.02.02. Aglaja Veteranyi ist tot. Wenig ist heute zu sagen: Ich bin sehr traurig. Ich habe Aglajya nur wenige Mal getroffen und war bewegt über ihre Herzlichkeit, Offenheit und – ich wage es hier kaum mehr zu schreiben – Lebensfreude. Das Gespräch mit Aglaja Veteranyi habe ich vor ziemlich genau zwei Jahren für die Monatszeitung «Toaster» geführt.

Es ist zwei Uhr Nachmittags. Langsam verebben die Geräusche in der Kronenhalle am Zürcher Bellevue; die letzten Wagen mit Essen werden zu den Gästen geschoben; ganze Heerscharen von Kellnern huschen vorbei; am Tisch nebenan wählt der Mann von Welt eine Zigarre; der Rauch steigt auf an den Gemälden der alten Meister vorbei zur hohen Decke. Und alles ist ein wenig alt und gelb – die Patina vergangener Zeiten, als Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt um die Wette schmauchten, hat sich hier festgesetzt. Die Schriftstellerin und Schauspielerin Aglaja Veteranyi liebt diesen Ort, und wer ihr zuhört, merkt, wie sich der Raum verwandelt, sich mit ihren Worten füllt, wenn sie über ihren ersten Roman «Warum das Kind in der Polenta kocht», über Tod und Leben und die Leidenschaft des Schreibens spricht.
Im Buch, erschienen diesen Sommer, wird die Geschichte einer Familie erzählt, die aus Rumänien in den Westen flieht, dort aber fremd bleibt und auseinanderbricht. Geschildert wird das Leben in der Zirkusmanege, in Hotels, Heimen und billigen Varietés aus der Sicht eines Kindes. «Ich konnte nur so und nicht anders schreiben. Nur aus der Perspektive des Kindes heraus, war ich fähig, all das Grausame, Unmoralische dieser Geschichte zu erzählen.» Allgegenwärtig ist der Tod. Die Mutter hängt in der Kuppel des Zirkus an den Haaren, und um das kleine Mädchen zu beruhigen erzählt die grosse Schwester die Geschichte vom Kind, das in der Polenta kocht. «Viele Leute und auch ein Teil der Medien erwarten vom Buch, dass sie mitgenommen werden in eine nostalgische Zirkuswelt. Wer das Buch liest, wird aber sofort merken, dass das mit der Realität nichts zu tun hat.» Sterben, Erfahrung der Fremde und Abschied sind die Themen, die Veteranyi in wunderbar präzisen, meist sehr kurzen Sätzen in Sprache gefasst hat. Bei Lesungen im Ausland lobe man die Leichtigkeit der Form, sagt sie. In Deutschland und der Schweiz begegne man dem knappen Stil mitunter mit Misstrauen. Man sieht den einfachen Sätze die Arbeit, die darin steckt nicht gleich an.
Ausbruch aus der geistigen Öde
Ich komme auf die vielen grausamen Szenen im Roman zu sprechen. Im Kinderheim muss aus Strafe das Erbrochene mit aufgegessen werden. Im Varieté wird dem Mädchen, weil es noch zu jung ist, um nackt aufzutreten ein behaartes Dreieck zwischen die Beine geklebt, gleichzeitig aber wacht die Mutter mit Argusaugen über dem Kind. Für Aglaja Veteranyi ist der gegen die Mutter gerichtete Wunsch – «Mich hat noch nie ein Mann am richtigen Ort berührt. Ich denke an nichts anderes. Ich will von zweien gleichzeitig vergewaltigt werden.» – so schockierend er auch tönt, etwas Befreiendes. Die Oberfläche einer scheinheiligen Welt bekommt Risse. Verdrängtes, wie das Verhältnis des Vaters mit der Schwester kommt zum Vorschein. «Wir stehen täglich vor der Wahl, Opfer oder Täter zu sein», zitiert Veteranyi einen Satz von Hilde Domin. «Das Mädchen, die junge Frau versucht sich aus dem primitiven Verhalten der Familie, die sich immer nur als Opfer der Verhältnisse wahrnimmt und in einer geistigen Öde lebt, auszubrechen.» In den vielen Deutungen der Geschichte des Kindes, das in der Polenta kocht, wechseln Opfer- und Täterrolle. Veteranyi betont denn auch das Parabel-, Gleichnishafte nicht nur dieser Geschichte, sondern des ganzen Romans. Soviel die Schriftstellerin auch über ihren Roman zu erzählen weiss, die Faszination bleibt ungebrochen, da wird nichts zerredet oder zu Tode erklärt, weil man stets die Präsenz und das Engagement dieser Frau hinter dem Text spürt.
In Diskussionen wird Veteranyi immer wieder mit der Frage nach dem Autobiografischen im Text konfrontiert. «Der Maler Henri Matisse sagte einmal ’Genauigkeit ist nicht Wahrheit.’ Der Roman ist nicht meine Lebensgeschichte; ich muss mir beim Schreiben jede Freiheit nehmen und sprachlich so präzis wie möglich sein. » Veteranyi hat sich in den fünfzehn Jahren, in denen sie schreibt, immer wieder mit dem Stoff, der nun ihr erstes Buch geworden ist, beschäftigt. Der Verlag und die Autorengruppe «Netz» haben ihr geholfen, die richtige sprachliche Form zu finden. Angst, das nun das Etikett «Zirkusroman» an ihr kleben bleibt, hat sie nicht. Ganz anders werde ihr neues Buch, und Schreiben sei für sie, die vor dem Roman schon eine grosse Zahl von Kurzgeschichten veröffentlicht hat, eine – mit zunehmend mehr Freude als Qual verbundene – alltägliche Arbeit: «Solange ich verletzlich bleibe, kann ich weiterschreiben.»
Aglaja Veteranyi, Warum das Kind in der Polenta kocht. Roman, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 1999, 190 Seiten, sFr. 27.50